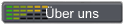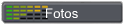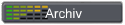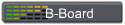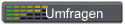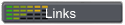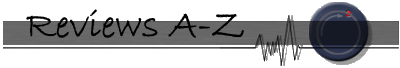


Künstler: Underoath
Album: Define the great line
Erscheinungsjahr: 2006
Anspieltipp: Moving for the sake of motion
Autor: Tobias
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mit einem markerschütternden Weckruf beginnt Underoaths mittlerweile bereits fünftes Studioalbum, das auf den Namen „Define the great line“ hört und bereits nach wenigen Sekunden klar macht, dass man den auf dem 2004er Vorgängerwerk „They’re only chasing safety“ eingeschlagenen Screamo-Weg anno 2006 definitiv nicht weiter geht. Vielmehr wird das Chamäleon der Hartwurstszene seinem Ruf während der gesamten 47 Minuten Spielzeit abermals gerecht, indem man neben den ureigenen Trademarks (wie beispielsweise das höchst markante und tragende Keyboardspiel) nun erstmals Noisecore-Elemente für sich entdeckt hat, die unterstützt durch viel Atmosphäre und sphärische Klänge eine nahezu vollständige Abkehr von poppiger Melodik und durchsichtigen Songstrukturen darstellen. Nicht selten erinnert der Sound der sechs Christ-Rocker nunmehr an Bands wie Norma Jean, Coalesce und As cities burn, wobei Underoath durch ihre repetierenden Gitarrenläufe fast schon monotoner Art ein weit bedrohlichere Grundstimmung als ihre neuerlichen Genre-Kollegen zu erzeugen wissen. Vermittelt das herausragende Cover-Artwork dabei noch einen eher ruhigen und verhaltenen Eindruck, so macht die darin eingebettete Tonkunst schnell klar, dass auf „Define the great line“ das pure Chaos herrscht! Nur noch höchst sporadisch werden die opaken Parts der einzelnen Songs dabei durch cleane Gesangspassagen versüßt, nicht aber etwa, um kommerziellen Ansprüchen genüge zu tun, sondern um den interessierten Hörer eine möglichst kontrastreiches, aber dennoch ineinander greifendes, Songspektrum anzubieten. Es wirkt daher fast schon provokant, wenn das rasende Gekeife des Frontmannes Spencer Chamberlain durch die zuckersüße Gesangsstimme des Drummers Aaron Gillespie unterbrochen wird, nur um im folgenden wieder in tumultartige Eruptionen auszubrechen, die nicht selten im stampfenden Midtempo verankert, jedenfalls aber durchweg imposanter Natur sind.
Der beschriebene Kontrast prägt dabei vor allem die ersten vier etwas zugänglicheren Stücke des Albums (insbesondere „A moment suspended in time“ erschließt sich bereits beim ersten Durchlauf; der Opener „In regards to myself“ einige wenige später), die anschließend aber durch ein episches Zwischenstück namens „Salmamir“ mehr als himmlisch in ein eher ausuferndes und beschwörendes Szenario übergeleitet werden, dass durch lange Instrumentalpassagen und noisige Versatzstücke den verstörten Hörer die völlige Euphorie entlockt. „Hitverdächtig“ wird er sich beispielsweise bei „Everyone looks so good from here“ etwas beirrt eingestehen müssen, das mit völlig gegenläufiger Rhythmik und der nötigen Portion Wahnsinn ausgestattet wurde, die schon Meshuggahs „Future breed machine“ zum kultigen Gassenhauer machte. Weniger hitverdächtig, dafür umso weitschweifiger ist „Casting such a thin shadow“ ausgefallen, das zunächst vier Minuten lang gänzlich ohne Gesang auskommt, welcher sich anschließend fast schon unbemerkt in die mahnende Songstruktur einschmeichelt und die Nummer so zum Glanzstück auf dem Silberling qualifiziert. Ähnlich dramatisch aufgebaut wurde „Returning empty handed“, der seine Urgewalt im Mittelteil durch Killing joke-artige Vocals entlädt und spätestens an dieser Stelle einen aufgeschlossenen und interessierten Hörer fordert, welcher hier eine sicherlich nicht sofort überquerbare Mauer an musikalischer Komplexität vor sich sieht. „Writing on the walls“ weist eine ebenfalls eher düstere Ausrichtung auf, erscheint dabei aber mit seinen kurzen melodischen Parts prädestiniert für eine (übrigens außerordentlich gelungene) audiovisuelle Singleauskopplung, die die neue musikalische Reife der Band auch optisch unterstreicht. Das abschließende „To whom it may concern“ lässt Hoffnung keimen, bietet erste Einbruchstellen der Sonnenstrahlen am wolkenverhangenen und beunruhigend anmutenden Himmel, inmitten ein letzter kolossaler Breakdown, um danach fast schon salbungsvoll dieses kleine Kunstwerk zu beschließen.
Ob des beschriebenen Songmaterials darf die Mainstream-Tauglichkeit des Silberlings also nun abschließend in Frage gestellt werden, so dass Underoath wohl kaum noch einmal 450.000 Exemplare ihrer Musik an den Mann bringen werden. „Define the great line“ ist daher als ein absolut mutiger Schritt einer Band zu qualifizieren, die sich gerade bei ihrem Major Debüt nicht wie das Fähnchen im Wind dreht, sondern sich sperriger und dadurch vielleicht sogar besser denn je präsentiert. In Sachen beste Underoath-Scheibe befindet sich „Define the great line“ nämlich absolut auf Augenhöhe mit dem 2000er Black Metal Meisterwerk „Cries of the past“, so dass hier nur die Höchstpunktzahl verteilt werden darf.

Copyright (c) 2004. Alle Rechte vorbehalten.